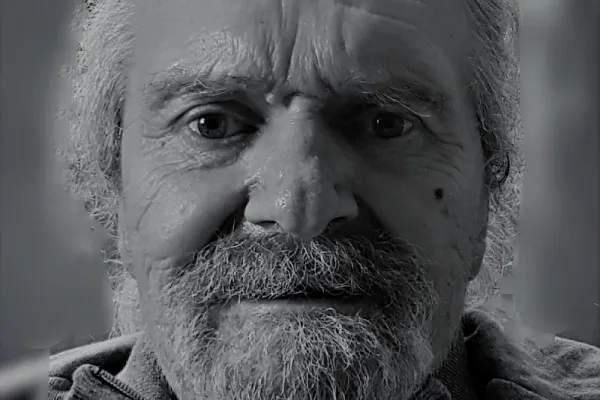28. Oktober 2019
Der Obelisk auf dem Petersplatz ist rund 3.000 Tonnen schwer und 4.000 Jahre alt. Caligula ließ ihn um das Jahr 40 nach Christus von Ägypten nach Rom schaffen und am Fuß des Vatikanhügels im Circus des Gaius aufrichten. Da stand er mehr als anderthalb Jahrtausende, als der einzige antike Obelisk Roms, der niemals umstürzte. Er stand also auch schon da, als der Circus des Gaius zum Circus der Nero geworden war, in dem Petrus um das Jahr 67 kopfüber gekreuzigt wurde, fahl beleuchtet von Mitgliedern der römischen Gemeinde, die als lebendige Fackeln für Jesus Christus links und rechts von ihm verbrannt wurden, am heutigen "Platz der Erzmärtyrer Roms".
Im Jahr 1586 ließ Papst Sixtus V. den Obelisken in einer technischen Meisterleistung von seinem alten Standort links neben dem Petersdom an seinen heutigen Standort verbringen. Den Petersplatz Berninis gab es noch nicht, auch nicht die heutige Fassade von Sankt Peter. Seitdem schmückt den riesigen Stein ein Kreuz, das Teile jenes "wahren Kreuzes" verwahrt, das Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, im Jahr 325 in Jerusalem entdeckte. An seinem neuen Standort ist der Obelisk dann auch ein Kalenderstein und eine Art Sonnenuhr geworden, der den längsten Schatten des Jahres zur Wintersonnenwende immer auf jenen Breitengrad fallen lässt, der über den Petersplatz auf den Apostolischen Palast zuläuft, in dem die Nachfolger Petri bis zur Wahl von Franziskus am 13. März 2013 residierten. Aber auch jetzt noch, wenn der Heilige Vater Sonntag für Sonntag zum Gebet des Angelus an das Fenster dieses Palastes tritt, fällt sein Blick auf den Stein in der Mitte der Piazza damit auch immer neu auf jenen Spiegel, der schon vor zweitausend Jahren den letzten Blick des Apostelfürsten aufgefangen hat.
Deshalb steht der Obelisk bis heute auch als ein Kronzeuge der Identität der apostolischen Kirche auf dem Petersplatz, das heißt als ein Zeuge dessen, was die Kirche in ihrem Wesen seit ihrer Gründung durch Jesus Christus ausmacht.
Zu diesem innersten Schatz zählt vorrangig die Feier der Eucharistie seit Anbeginn. "Ohne den Sonntag können wir nicht leben!" antworteten im Jahr 304 Christen aus Abitene im heutigen Tunesien ihrem Richter, der sie dafür dem Tod übergab. - Die Eucharistiefeier ist "Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens", haben die Konzilsväter des II. Vatikanums noch 1964 in ihrer dogmatischen Konstitution Lumen Gentium formuliert.
Doch als christliche Missionare im Jahr 1640 aus Japan vertrieben wurden, ließen die Jesuiten – wie der heilige Maximilian Kolbe dort erfahren hat - den einheimischen Christen nur den Rosenkranz zurück, sonst nichts, keine Priester, keine Kirchen, keine Sakramente, keine Eucharistie. Bibeln waren streng verboten. Als über 200 Jahre später aber wieder ausländische Priester ins Land gelassen wurden, trafen sie bald auf geheime und blühende christliche Gemeinden, die sich die ganze Zeit über nur an dem Rosenkranz festgehalten hatten, der sie lebendig erhielt.
Vielleicht sollte dieses Rosenkranzwunder den Heiligen Vater ja auch heute für sein Schlussdokument zur Synode noch einmal inspirieren, wie der Not der Priesterarmut vielleicht am besten zu begegnen ist mit einer authentischen Verehrung Gottes und seiner Mutter anstatt einer waghalsigen Hinwendung zur Mutter Erde.
Zum Wesen der Kirche gehört aber auch, dass Jesus von Nazareth ein Jude war, geboren von einer jüdischen Mutter. Sein Gesetz war die jüdische Thora, wo es im ersten der zehn Gebote vom Sinai heißt: "Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir." Genau dieses Gebot bescherte der Kirche nach dem Kreuzestod Christ in ihrer Frühzeit Legionen von Märtyrern, die sich weigerten, dem göttlichen Kaiser oder anderen Göttern auch nur ein Körnchen Weihrauch zu opfern. Da gingen sie keinen Kompromiss ein. Dafür sind sie zu Tausenden gestorben, in Ägypten, Afrika, Asien und Europa, in Arenen, am Kreuz, in ungelöschtem Kalk, unter jedem Marterwerkzeug, weil sie sich in dieser Frage nicht beugen lassen wollten.
Das war in den ersten Jahrhunderten ihr Alleinstellungsmerkmal unter allen Religionen und Nationen: Neben Christus, in dem Gott sein Gesicht geoffenbart hatte, wollten sie keine anderen Götter mehr verehren, auch nicht dem Anschein nach, wie wohlgesinnte Richter es ihnen hier und da nahelegten, um ihr Leben zu retten.
Weil sie Göttern aber auch keine Kleinigkeiten mehr opfern wollten , wurden die ersten Christen bald ringsum das Mittelmeer als Störenfriede und Spielverderber scheel angesehen und sogar als gottlos beschimpft.
Ähnliche Vorwürfe hören Katholiken heute aber unversehens inmitten ihrer Kirche von einem lautstarken Teil ihrer Mitbrüder und Schwestern, weil sie sich plötzlich heimatlos fühlen angesichts jener befremdenden Bilder, die sich aus der Amazonas-Synode schneller und deutlicher als alle Worte um den Erdball verbreitet haben, die zeigen, wie um den Platz der Erzmärtyrer Roms plötzlich heidnischen Götterbildern mit Prozessionen und Räucherwerk und Liedern gehuldigt wird. Stürzt und bricht als Nächstes der Obelisk?
Vielleicht sollte der Heilige Vater für das Verfassen seines päpstlichen Schlusswortes doch noch einmal aus dem ehemaligen Hotel des Vatikans in den Apostolischen Palast seiner Vorgänger umziehen, um aus dessen bescheidenen Räumen auf den Obelisken zu schauen und sich neu an die Identität der Kirche Christi erinnern zu lassen, die doch auf Petrus, dem Felsen ruht. Oremus!
Das könnte Sie auch interessieren:
Amazonas-Synode: Schlussdokument fordert Weihe verheirateter Priester https://t.co/EMHMtaCexZ #Zölibat #ViriProbati #SinodoAmazonico #Kirche
— CNA Deutsch (@CNAdeutsch) October 26, 2019
https://twitter.com/CNAdeutsch/status/1188195693636116480?s=20
Erhalten Sie Top-Nachrichten von CNA Deutsch direkt via WhatsApp und Telegram.
Schluss mit der Suche nach katholischen Nachrichten – Hier kommen sie zu Ihnen.
https://twitter.com/cnadeutsch/status/1170302811747340288?s=21
Hinweis: Meinungsbeiträge wie dieser spiegeln die Ansichten der jeweiligen Autoren wider, nicht unbedingt die der Redaktion von CNA Deutsch.