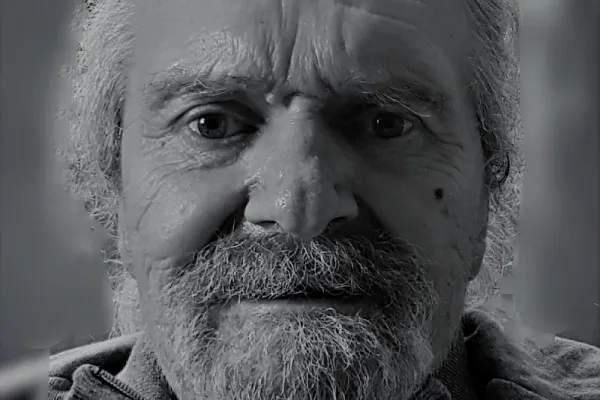8. Juli 2024
Der folgende Beitrag von Paul Badde erschien zuerst in der Schweizer Wochenzeitung „Die Weltwoche“.
Christen glauben das Unglaubliche, und sie halten das Unfassbare für wahr. Diesen Glauben darf man sich wie eine prächtige, mächtige Kathedrale vorstellen, einerseits. Andererseits ist derselbe Glaube aber auch ein Haus der Skandale mit einer Hierarchie von Zumutungen, von denen nie genug erzählt werden kann und denen hier und heute eine letzte Unglaublichkeit hinzugefügt werden soll.
Die Skandalgeschichte des Glaubens fing schon im Judentum an, als sich in Chaldäa, auf dem Boden des heutigen Irak, die Ahnung eines Nomaden namens Abram zu der Überzeugung verdichtete, die ihn danach etwa Folgendes zu den Stämmen sagen ließ, unter denen er seine Zelte aufschlug: „Es gibt nicht Hunderte von Göttern, wie ihr glaubt. Es gibt nur einen einzigen Gott. Er hat nicht nur Himmel und Erde erschaffen und die Sonne und Sterne, von denen ihr denkt, dass sie Götter sind. Doch das ist leider Unsinn. Es sind nur Lampen am Himmel, die mein und unser Gott erschaffen hat. Er hat überhaupt alles erschaffen und schließlich auch den Menschen, als Mann und als Frau, nach seinem Vor- und Ebenbild!“
Würde, nicht Ehre
Kulturgeschichtlich gesehen, war es eine bodenlose Frechheit, zu der sich der Scheich da erkühnte – bevor unter seinen Nachkommen auch noch der zweite unfassbare Skandal seinen Anfang nahm, jedoch mehr als 2000 Jahre später. Das war, als zwölf Männer und einige Frauen Israels in Jerusalem plötzlich gegen all ihre Schriftgelehrten aufstanden und behaupteten: „Der Schöpfer des Himmels und der Erde hat sich uns persönlich gezeigt, uns und euch. Er hat mit uns gelebt und gegessen, und ihr habt ihn verhaften und hinrichten lassen. Der Tod konnte ihn aber nicht halten. Er ist aus dem Grab auferstanden. Er lebt, wir haben ihn gesehen und wieder mit ihm Mahl gehalten.“ Wen will da wundern, dass diese Nachricht in den Ohren der meisten Menschen Judäas, Samarias und Galiläas noch viel aufreizender und skandalöser klang als die Nachricht jenes neuen Glaubens, mit dem die ersten Hebräer zwei Jahrtausende zuvor Ägypten und Babylon entsetzt hatten, die mächtigen Großreiche der Sonnenreligion und der Sternenkulte südlich und nördlich des kleinen Israel zwischen Jordan und Mittelmeer.
Größer aber als die unglaubliche Auferstehung Christi von den Toten und alle Wunder, von denen diese „Apostel“ sonst noch erzählten, wie die ersten zwölf Zeugen der Christenheit genannt werden, ist überhaupt aber das Urwunder der Christenheit.
Das ist die Menschwerdung Gottes aus einer Frau. Das ist die Überzeugung, dass der Allergrößte und Höchste, der nach dem Glauben Israels Himmel und Erde und überhaupt alles geschaffen hatte, dass dieser unfassbare Gott sich im Leib einer jungen Jüdin in einer winzigen unbefruchteten Eizelle eingenistet hatte, um mit seiner Geburt der ganzen Menschheit „das menschliche Gesicht Gottes“ zu zeigen, wie Papst Benedikt in seinen letzten Amtsjahren nicht müde wurde, immer neu zu betonen. Das ist endlich vollends unfassbar.
In der ganzen Menschheitsgeschichte ist keiner Person – ob Mann oder Frau – je solche Würde zugesprochen worden. Ich sage Würde, nicht Ehre. Denn neun Monate in innigster Intimität mit Gott zu leben wie eine Mutter mit ihrem ungeborenen Kind, ist ja etwas ganz, ganz anderes, als ein Stelldichein mit Gott zu haben, wie es auch von vielen Heiligen überliefert ist. Der Name der Frau war Maria.
Da wundert es nicht, dass der Christenheit nach ihren ersten zwölf Zeugen nicht nur eine „apostolische Struktur“ innewohnt, sondern dass sie auch von Anfang an eine zutiefst weibliche Dimension hatte, die Hans Urs von Balthasar in Basel „das marianische Prinzip“ der katholischen Kirche nannte. Doch der Reihe nach: Von den Aposteln erzählen alle Grundlagentexte der Christenheit. Das sind neben allen Schriften der hebräischen Bibel die vier „kanonisch“ genannten Evangelien der Autoren Markus, Matthäus, Lukas und Johannes und die gesamte „Apostelgeschichte“, die Lukas allein verfasst hat. Dazu kommen noch 21 verschiedene Briefe. Von Maria hingegen haben wir nur eine Handvoll Worte, die allesamt von Lukas stammen. Es gibt jedoch kein Evangelium Marias.
O heilige Gottesgebärerin
Aus Ägypten stammt allerdings ein Papyrus-Fragment, das Maria schon im 3. Jahrhundert auf Griechisch mit folgenden Worten rühmt und anfleht: „Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau.“ Es ist das älteste Mariengebet, das wir kennen. Und es entstammt jener Kultur am Nil, in der es im 1. Jahrhundert nach Christus eine blühende Porträtkunst in antiker „enkaustischer“ Wachstechnik gab mit außerordentlich lebendigen Gesichtern, die heute als Vorläufer aller christlichen Ikonen betrachtet werden. Und aus ebendiesem Zeitraum stammt auch das unsterbliche Gerücht, der nichtjüdische Evangelist Lukas aus der hellenistischen Metropole Antiochia habe nicht nur sein einzigartiges Evangelium gemalt, sondern er habe auch die erste Ikone Marias zu ihrer Lebzeit „geschrieben“, wie es in der Welt der Orthodoxie heißt.
Nun gibt es allein in Rom mindestens elf solcher „Lukas-Ikonen“. Es sind hochverehrte Exemplare, von denen allerdings leicht ersichtlich ist, dass sie grosso modo aus dem Mittelalter stammen müssen. Weltweit sind es etliche mehr. Interessanter als all diese einzelnen Ikonen ist deshalb die Frage, ob ihnen nicht ein einziges gemeinsames Vorbild zugrunde liegt. In Rom zum Beispiel galt es jahrhundertelang als ausgemacht, dass es sich bei der uralten Wachs-Ikone der sogenannten „Advocata“ um ebendiese Bildtafel handeln müsse, die Domingo de Guzmán am 28. Februar 1221 in das Sisto-Kloster getragen hatte. Und die Nonnen des Klosters glauben bis heute weiter unverdrossen daran. In der Welt der Kunst und ihrer Geschichte gilt eine solche Behauptung natürlich schon lange als unhaltbar, und keiner wagt es mehr, sie zu verteidigen.
Als ich diese Ikone aber am 11. Januar 2006 erstmals im Rosenkranzkloster auf dem Monte Mario hinter ihrem Gitter sah, bannte mich ihre Erscheinung dennoch sogleich wie kein Gemälde je zuvor. Der Gedanke an eine Autorenschaft des Evangelisten Lukas schien mir dennoch nur absurd. Freunden und anderen Menschen, die ich von da an ihrer faszinierenden Ausstrahlung zuliebe in großer Zahl zu ihr hinaufführte, erzählte ich nur immer wieder von der ältesten Ikone Roms aus vorbyzantinischer Zeit, mit der ich sie bekanntmachen wollte und die in der Frühzeit einmal dem heiligen Lukas zugeschrieben wurde.
So verhielt es sich lange mit der längsten Reportage meines Lebens, die vor über zwanzig Jahren für mich in Jerusalem begann und in Rom endlich ihr Ziel fand, wo ich nun sage: Es stimmt, es gibt wirklich kein Evangelium Marias. Denn zuerst taucht kein Buch, sondern ein Bild von ihr auf. Das ist dieses Bild. Es kann gar nicht anders sein, als dass es noch zu Lebzeiten Marias entstand und dass es von keinem anderen als von Lukas auf dem Zionsberg in Jerusalem im Jahr 48 geschaffen wurde. Dafür gibt es viele Indizien, die mühsam zu sammeln und auszuwerten waren. Der härteste Prüfstein aber war und blieb immer die eigene Skepsis. Die Sorge, mich lächerlich zu machen, gehörte nicht dazu.
Pflastersteine als Stolpersteine
Denn was ich hier behaupte, ist ohnehin weit jenseits dessen, wohin westliche Theologen einem Journalisten zu folgen bereit sind, der sich weniger auf ein Studium als den eigenen Augenschein zu verlassen gelernt hat. Die Entfremdung der Theologen Westeuropas von der Kunst des Glaubens ist lang und tief, wobei sie die Kompetenz in Bilderfragen weitgehend an die Experten der Kunstgeschichte abgegeben haben. Aus diesen Streitfragen hält sich die „Advocata“ auf dem Monte Mario am Stadtrand Roms allem Augenschein nach allerdings vollkommen heraus. Auf wunderbare Weise hat sie viele Stürme überlebt. Alle Bilder, die jemals dem heiligen Lukas zugeschrieben wurden, gehen auf ihr Vorbild zurück.
Erhalten Sie Top-Nachrichten von CNA Deutsch direkt via WhatsApp und Telegram.
Schluss mit der Suche nach katholischen Nachrichten – Hier kommen sie zu Ihnen.
Doch die Kirche, wo die Ikone verehrt wird, ist versteckt und viel zu klein für Pilgermassen; der Ort auch viel zu abgelegen. Kein Tram fährt hier hinauf, die Busverbindung ist kompliziert. Auf dem schmalen, überwucherten Weg, der an der Klostermauer entlang zu ihr hinführt, ragen etliche Pflastersteine als Stolpersteine heraus. Man könnte Sorgen haben, dass sich hier nur ja kein Pilger – Gott behüte! – den Hals bricht. Weil die kleine Kirche des Rosenkranzklosters aber nicht, wie sonst bei Kirchen üblich, mit ihrer Apsis nach Osten weist, sondern nach Westen, durchflutet an vielen Tagen morgens durch das gläserne Hauptportal das Licht der aufgehenden Sonne den Raum von Osten her.
Und hinter ihrem Gitter hat das verborgene Weltwunder überhaupt das kostbarste Versteck, das sich für die erste Ikone Marias nur wünschen lässt. Das ist das immerwährende Gebet und der Gesang dieser letzten Töchter des heiligen Dominikus in Rom. Unter ihnen sehen wir der Frau ins Gesicht, in deren Leib der Schöpfer des Himmels und der Erde die menschliche Gestalt ihres Sohnes angenommen hat. Kein Geschöpf des Universums war dem Schöpfer des Himmels und der Erde jemals so lange so nah. Ihre heilige Intimität mit Gott ist Marias tiefstes Geheimnis. Und durch sie hat Gott quasi alle Christen – ob Frauen oder Männer – in Empfangende verwandelt, was seine Wahrnehmung betrifft.
Verstoß gegen das Gesetz des Moses
Die Ikone des heiligen Lukas „erzählt“ und verschlägt einem die Sprache. Sie ist ein Bildwunder, evangelisch wie das Evangelium, überirdisch schön und das bleibende Bilddokument des Apostelkonzils, in seiner ultimativen Verdichtung. Und ein Wunder, das sich ganz zuverlässig wiederholt, ist die Erfahrung vom Glück des Gebets, das sich hier mit fast jedem Menschen teilen lässt. Diese „Anwältin“ macht offenbar, dass der Glaube der Dominikanerinnen durch die Jahrhunderte alle universitäre Kunstfertigkeit und jeden akademischen Dünkel überragt. Ihre Lippen sind geschlossen wie zu einem jener Küsse, mit denen sie ihren Neugeborenen in Bethlehem liebkost hat.
Ich hatte die älteste Ikone der Welt gesucht und die Ikone des Evangelisten Lukas gefunden. Die beiden sind ein und dieselbe. Lukas wusste, dass er ein Ebenbild der Mutter Gottes malte und dass es ein nie dagewesener Tabubruch und Verstoß gegen das Gesetz des Moses war. Hinter dem Gitter des Rosenkranzklosters in Rom schaut uns die Fürsprecherin nicht nur als das authentischste aller Madonnenbilder von Ost und West an. In diesem lebendigen Fragment ist die vielfach gespaltene Christenheit selbst noch eins. Wahrscheinlich nie mehr so sehr wie in jenem Moment. Hier schauen wir in ihr unverletztes Gesicht und auf die noch ungetrennten und ungeschiedenen Geisteswelten von Wort und Bild. Sie anzuschauen, heißt: einer lebendigen Person zu begegnen. Sie auch nur anzublicken, ist der Anfang eines immerwährenden Gebets.
Nur verglichen mit den monströsen Skandalen am Anfang unseres Glaubens ist die Behauptung von der Urheberschaft des Lukas an dieser Meister-Ikone eine winzige Kleinigkeit.
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von „Die Weltwoche“. Das Buch „Die Lukas-Ikone“ von Paul Badde kann direkt beim fe-Medienverlag bestellt werden.